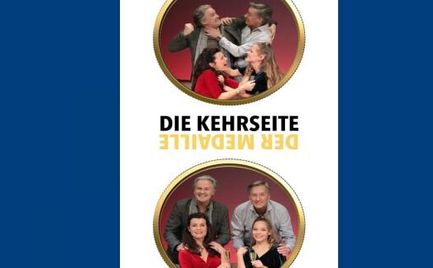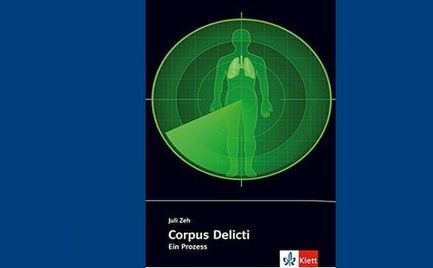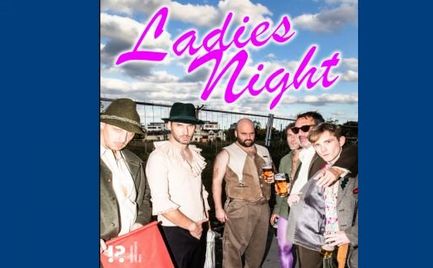Willkommen in Peine...

... einer Stadt, die ihre reiche Geschichte lebendig bewahrt und dabei mit Dynamik in die Zukunft schreitet. Die Stadt Peine verbindet historisches Erbe, pulsierende Tradition, idyllische Natur und innovative Wirtschaft zu einem Ort, an dem man sich wohlfühlt. Die Fuhsestadt mit ihren 52.000 Einwohnern ist bekannt für ihre jahrhundertealten Traditionen ebenso wie als Mekka der Stahlindustrie. Erkunden Sie die malerischen Gassen mit Fachwerkhäusern und den geschichtsträchtigen Marktplatz - das "Wohnzimmer" Peines, wie man hier gerne sagt. In Peine erleben Sie urbanes Leben und Natur zugleich – grüne Oasen, Parks und Seen laden zu entspannten Spaziergängen, Radtouren und Picknicks ein.

Überzeugen Sie sich selbst von der herzlichen Atmosphäre in Restaurants und Cafés und erleben Sie außergewöhnliche Events wie das schottische Highland Gathering im Mai oder das traditionelle Freischießen im Juli. Treffen Sie inspirierende Menschen, teilen Sie genussvolle Momente und entdecken Sie die kulinarische Vielfalt Peines – von lokalen Köstlichkeiten bis hin zur weltbekannten Schokolade. Als traditionelle Stahlstadt, historische Bierstadt, liebenswerte Eulenstadt und dynamischer Wirtschaftsstandort bewegt sich Peine im Spannungsfeld von Historie und Zukunft. Lernen Sie die Fuhsestadt und ihre Menschen kennen – wir freuen uns auf Sie!
Aktuelles aus Peine
-

Aktuell Zukunftstag 2024
26.04.2024
Acht neugierige Nachwuchstalente der 5. bis 7. Klasse erlebten einen aufregenden Tag bei uns und schnupperten in die Bereiche Eventplanung, Tourist-Info, Grafik, Citymanagement und Kommunikation.
Weiterlesen -

Aktuell Hörspaziergang durch Peine
23.04.2024
Tauchen Sie ein in die Welt der Migration und entdecken Sie die bewegenden Geschichten von türkischen Einwanderern, die einst ihre Heimat verließen, um in Peine eine neue Zukunft aufzubauen.
Weiterlesen -

Förderung Presse Neue Stadtmarke zum Anfassen
19.04.2024
Peine bekommt ein neues Gesicht und das möchten die Stadt Peine und Peine Marketing gemeinsam mit allen Peinerinnen und Peinern feiern - am Samstag, 27. April, ab 9.30 Uhr auf dem Historischen Marktplatz!
Weiterlesen -

Presse Schottisches Kulturfest im Peiner Stadtpark
12.04.2024
Das jährliche Highland Gathering verwandelt Peine erneut in eine schottische Hochburg. In 2024 findet das Fest am Wochenende des 4. und 5. Mai statt und wird von einem verkaufsoffenen Sonntag begleitet.
Weiterlesen
Aktuelle Veranstaltungen
Erlebnisse für Entdecker

Langeweile? Gibt es in Peine nicht, denn hier gibt es unzählige Ausflugsziele...

Peine2go - unsere Stadt-App ist Ihre Eintrittskarte zu den vielfältigen Schätzen unserer charmanten Fuhsestadt

Historie: Auf den Spuren einer über 800-jährigen Stadtgeschichte - Ihre persönliche Eintrittskarte zu unvergesslichen Entdeckungen!

Junges Peines - entdecke viele Freizeittipps only for kids

Tradition + Geselligkeit: Events 2024 ... in Peine ist immer was los

Augmented Reality - wenn die Peiner Burg virtuell aufersteht

"Peine, was geht?" - der Podcast direkt aus der Peiner Innenstadt

BikePorts, Anreise + Parken, Spielzeug ausleihen - hier gibt es einen informativen Blick auf die Stadt

Genuss pur! Entdecken Sie kulinarische Köstlichkeiten, die es so nur hier in Peine gibt!